Wer durch Ilfeld spaziert und nicht den Blick hebt, entdeckt ihn nicht sofort: den Hirsch auf dem Dach. Majestätisch thront er tatsächlich auf dem Dachreiter des Nordflügels der Neanderklinik Harzwald – ein 12-Ender, wie es scheint. Was zunächst wie ein dekoratives Detail wirkt, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als architektonisches und historisches Statement, meint der Autor. Denn dieser Dachreiter erzählt uns eine Geschichte, die tief in die Heraldik des Südharzes hineinreicht. Beim Bau des Gebäudekomplexes mag man explizit an Stolberg erinnert haben wollen, nur der Hintergrund könnte weiter gefasst sein.
Architektur mit Symbolkraft
Der Bau der Neanderklinik stammt aus dem 19. Jahrhundert, doch der Dachreiter mit Hirsch verweist auf ältere Traditionen. Solche Aufbauten – sogenannte Dachreiter – dienen nicht nur der Gliederung eines Gebäudes, sondern oft auch als Träger symbolischer Botschaften. In diesem Fall ist es der Hirsch, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und das ist nicht zufällig.

Die Krypta als Schlüssel
Im Inneren des Nordflügels befindet sich die Krypta – ein exklusives Museum deutscher Geschichte. Dort steht das berühmte Steinoblognum des Dynastenpaars Lutrude und Elger II, dem ersten Grafen von Honstein aus Ilfelder Linie. Lutrude ist dargestellt mit einer Geweihstange in der Hand, Elger II mit seinem Wappen: zwölffach geschacht in Silber und Rot. Diese Kombination aus Geweihsymbolik und Schachung zieht sich durch die Heraldik der Region.
Drei Linien – ein Motiv
Der Hirsch auf dem Dach ist mehr als Zierde. Er steht für eine heraldische Verbindung dreier bedeutender Adelslinien des Südharzes (?):
| Linie | Wappentier / Motiv | Farben | Bedeutung |
| Klettenberg | Rotes Hirschgeweih | Silber / Rot | Jagdrecht, Wachsamkeit |
| Stolberg-Wernigerode | Schwarzer Hirsch | Gold / Schwarz | Adel, Naturverbundenheit, Standhaftigkeit |
| Hohnstein | 12-fach geschacht | Silber / Rot | Ordnung, Wehrhaftigkeit, Reinheit |
Klettenberg: Bereits im 12. Jahrhundert führten die Grafen von Klettenberg ein rotes Hirschgeweih auf silbernem Grund. Es symbolisierte Stärke, Wachsamkeit und territoriale Souveränität. Das Motiv taucht in Siegeln und Ahnenproben auf – etwa bei Konrad von Clettenberg (1240). Stolberg-Wernigerode: Die Linie Stolberg-Wernigerode übernahm später das Hirschmotiv in schwarzer Farbe auf goldenem Schild. Der Hirsch steht hier für Standhaftigkeit und Naturverbundenheit. Das Wappen wurde 1892 durch Emil Doepler überarbeitet und prägt bis heute die visuelle Identität der Region. Ho(h)nstein kann als ein Kern angesehen werden: Die Grafen von Hohnstein führten ein zwölffach geschachtes Wappen in Silber und Rot – ein Symbol für Ordnung und Wehrhaftigkeit. Ihr Stammsitz, die Burg Hohnstein bei Neustadt/Harz in der Gemeinde Harztor, war ein Zentrum mittelalterlicher Macht im Südharz. Heraldik als Identität? Der Hirsch auf dem Dachreiter der Neanderklinik ist somit nicht bloß ein dekoratives Element. Er ist ein heraldischer Verweis auf die Geschichte der Region, auf Dynastien, die das Harzvorland und auch das Reich seinerzeit prägten, auch auf die symbolische Kraft von Tiermotiven in der Architektur. Die Geweihstange in Lutrudes Hand, das geschachte Wappen Elgers auf dem berühmten Steinoblognum im Museum Krypta der Neanderklinik Harzwald, die genealogischen Spuren in Ahnenproben, sogar überregional zu finden (Offenbach) – all das verdichtet sich hier in einem einzigen Blick nach oben.
Ein Dachreiter als Denkmal
Wer den Hirsch sieht, sieht mehr als ein Tier. Er sieht die Geschichte des Südharzes, gegossen in Metall und erhoben über die Dächer Ilfelds. Ein architektonisches Augenzwinkern – und ein heraldischer Hochgenuss. Oder seht Ihr es etwa anders?
Text und Bild: Tim Schäfer
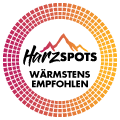

 Vorheriger
Vorheriger Nächster
Nächster